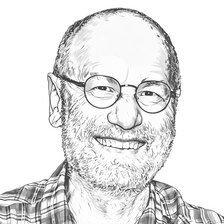Die beiden Ärzte Urs Allenspach und Pepo Frick haben während Jahren in Afrika gearbeitet. Im Interview sprechen sie über hartnäckige Vorurteile, die Veränderung in der medizinischen Versorgung und was wir von den Menschen in Simbabwe lernen können.

«Wir sind uns ähnlicher, als wir meinen»
Interview von Raphael Amstutz, freischaffender Journalist
Urs Allenspach, gab es ein Initialereignis, das Sie als Arzt in den 80er-Jahren nach Afrika geführt hat?
Urs Allenspach: Ich habe während meines Studiums für einige Monate in Kamerun gearbeitet. Aufgrund dieser wertvollen Erfahrungen wollte ich den Kontinent Afrika, der mir damals unbekannt war, besser kennenlernen. Dank der Schweizer NGO Solidarmed bin ich später mit Frau und Kindern nach Simbabwe gegangen und habe während einigen Jahren zusammen mit einem zweiten Arzt ein Distriktspital geleitet.
Ist Ihnen der Kontinent rätselhaft geblieben?
Allenspach: Ja, auch heute verstehe ich einiges nicht. Gleichzeitig habe ich erlebt: Die Menschen dort haben die gleichen Sorgen und Nöte. Wir sind uns ähnlicher, als wir meinen.
Wie war es bei Ihnen, Pepo Frick?
Pepo Frick: Ich hatte die gleiche Motivation wie Urs. Der riesige Vorteil ist, dass sich unser Beruf in jedem Land der Welt ausüben lässt.
Sie haben in katholischen Spitälern gearbeitet. Gab es den Wunsch, dass Sie missionieren?
Beide (bestimmt): Nein. Diese Krankenhäuser sind wichtig für die lokale Bevölkerung und haben eine lange Tradition. Es wurde nie verlangt, dass wir uns religiös positionieren.
Womit wir beim Thema Kolonialisierung wären …
Allenspach: Das ist und bleibt ein wichtiges Thema. Wir haben immer einen Austausch auf Augenhöhe gehabt. So wurde unsere konkrete Arbeit als Ärzte nie zur Einbahnstrasse.
Frick: So sind wir zu Botschaftern dieses wunderbaren Kontinents in der Schweiz geworden.
Allenspach: Wir wollen, gerade auch mit unseren Reisen, Verständnis und Interesse wecken, Klischees hinterfragen und Vorurteile abbauen.
Frick: Eines der stärksten ist: Afrika ist ein schillernder Kontinent mit über 50 unterschiedlichen Staaten, wird aber immer wieder als ein Land wahrgenommen.
Wie kann ich mir als Laie das Gesundheitssystem von Simbabwe vorstellen?
Allenspach: Es ist ähnlich organisiert wie hier: es gibt Uni-, Provinz- und Distriktspitäler. Was aber fehlt, sind Praxen mit hausärztlichem Angebot. Stattdessen gibt es sogenannte Aussenkliniken in den Dörfern, besetzt mit bestens ausgebildetem nicht-ärztlichem Personal, in denen ein beschränkter Zugang zu Medikamenten möglich ist. Ein eindrücklicher Vergleich: In Simbabwe sind auf dieser Stufe rund 100 essenzielle Medikamente vorgesehen, hier bei uns sind es über 2000.
Woran mangelt es am meisten?
Frick: Das System ist schlicht ausgehungert und unterfinanziert. Dazu kommt, dass nur 5 Prozent der Menschen eine Krankenversicherung haben. Die meisten bezahlen also ihre Behandlungen selber, gleichzeitig gelten 80 Prozent der Bevölkerung als arm. Die Folge: eine zusätzliche Verarmung, wenn für die medizinische Behandlung Kredite aufgenommen werden müssen. Verzögerungen durch fehlende Finanzen können tödlich sein. Ein weiteres Problem ist der Braindrain. Hoch qualifizierte medizinische Fachkräfte werden von reichen Ländern abgeworben.
Woher kommt die Unterstützung?
Allenspach: Entscheidend ist die Diaspora, also die im Ausland lebenden Menschen aus Simbabwe: rund sechs Millionen schicken pro Jahr gegen 5 Milliarden US-Dollar ins Land. Die Solidarität basiert also nicht auf einer obligatorischen Grundversicherung, sondern auf der Hilfe durch die Familien und Verwandten.
Gibt es auch Hoffnung?
Frick: Ja. Ich sehe eine Verbesserung der Versorgung in den letzten Jahrzehnten. Zahlreiche Parameter stimmen positiv, so sind Kinder- und Müttersterblichkeiten deutlich gesunken.
Allenspach: Es gibt medizinische Fortschritte, vor allem im ambulanten Bereich. Doch es bräuchte mehr staatliches Bewusstsein und Fokussierung auf die medizinische Grundversorgung. Allerdings gilt es, die Dimensionen – absolut und prozentual – im Auge zu behalten: die Schweiz gibt über 12 Prozent ihres Bruttoinlandproduktes für Medizin und Gesundheit aus, in Simbabwe sind es weniger als 3 Prozent. Der Staat konzentriert sich eben vermehrt auf Bereiche, die finanzielle Erträge bringen. Es gibt zahlreiche Verteilkämpfe und viel Energie wird durch das stark klientelistisch geprägte System gebunden.
Frick: Die politische Verantwortung wird nicht genug wahrgenommen, die nötigen Ressourcen werden nicht bereitgestellt. Es herrscht ein rhetorischer Sozialismus.
Allenspach: Kommt dazu, dass ein Arzt, der umgerechnet etwa 250 Franken pro Monat verdient, einen zweiten Job braucht, damit es reicht. Das hat einen Einfluss auf die Qualität, das Angebot und die Verfügbarkeit medizinischer Angebote.
Das klingt düster.
Allenspach: Nein, realistisch. Wir haben vorhin von Vorurteilen gesprochen. Es ist enorm wichtig, dass wir nicht in dieses «In Europa ist alles gut, in Afrika alles schlecht» verfallen.
Frick: Oder etwas weiter gefasst: Eurozentrismus ist eine Sicht, die dem Verständnis des grossen Ganzen nicht zuträglich ist.
Gibt es etwas, das die Schweiz von Simbabwe lernen kann?
Frick: Ja, mit eigentlich unzureichenden Ressourcen das Maximum anzustreben.
Allenspach: Seitens der Patient*innen: ich würde mir hier etwas mehr Bescheidenheit wünschen und eine realistischere Anspruchshaltung. Ich will nicht romantisieren. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das natürlich nicht 1:1 kopiert werden kann. Dafür sind die Länder, die Systeme und die Voraussetzung viel zu unterschiedlich. Trotzdem: Es geht um eine Grundhaltung der Menschen in medizinischen Dingen, die ich in Simbabwe bewundere.
Wie haben Sie für Ihre Arbeit als Ärzte profitiert?
Frick: Wir haben gelernt, flexibel zu sein, zu improvisieren und zu akzeptieren, was ist. Wir haben gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen, die wir nie erlebt hätten, wären wir nur in der Schweiz medizinisch tätig gewesen.

Was braucht es, damit man das gut übersteht?
Allenspach: Die Unterstützung der Familie ist absolut entscheidend. Dazu braucht es eine gewisse Robustheit. Humor ist auch wichtig. Und die Bereitschaft, Anteil zu nehmen: ich wollte immer miterleben und den Alltag dieser Menschen verstehen. Was sicher nicht hilft: Pessimismus und der Hang zum Nörgeln.
Davon soll auch etwas während Ihrer Reisen zu spüren sein?
Frick: Unbedingt. Wir wollen die Mitreisenden mit den Lebensrealitäten der lokalen Bevölkerung in Kontakt bringen, raus aus der touristischen Komfortzone. Wir bringen unsere Erfahrung ein, möchten, dass die Menschen einen Bezug aufbauen können zum Land und wegkommen von den mitunter stereotypen Vorstellungen, die wir hier in Europa von Afrika haben.
Allenspach: Wir romantisieren aber auch nicht. Wir zeigen die schwierigen und unschönen Seiten ebenso, machen auf Probleme aufmerksam. Wir wollen ein ausgewogenes Bild zeigen, das gesamte Bild.
Und was bleibt am Schluss?
Beide: Nicht selten: Mehr Fragen als Antworten. Das ist kein schlechtes, sondern ein gutes Zeichen. So kommt es auch, dass regelmässig Menschen die Reise ein zweites Mal mitmachen.
Seit 2014 organisieren Urs Allenspach und Pepo Frick Reisen nach Simbabwe. Allenspach: «Mein besonderes Interesse gilt der Kultur und den Traditionen der lokalen Bevölkerung, aber auch der exzellenten Kunst in dieser Region.» Frick: «Mein direkter Bezug zu Afrika hat mir sehr viel gegeben und mich auch nachhaltig verändert.»